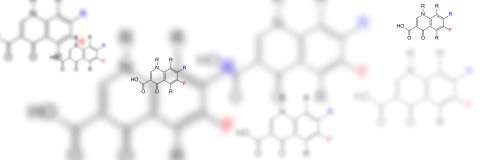FQAD
FQAD steht für Fluoroquinolon Acquired Disease, manchmal begegnet einem als Auflösung des Akronyms FQAD auch: Fluoroquinolone Associated Disability, zu deutsch: eine mit der Einnahme eines Stoffes aus der Gruppe der Fluorchinolon-Antibiotika zusammenhängende Behinderung.
Im Gegensatz zum englischsprachigen Raum und der Schweiz ist dieses ernste Krankheitsbild in Deutschland wenig bis kaum bekannt, weswegen ich in persönlichen Gesprächen mit Haus- und Fachärzten, im Rahmen meiner Vorlesung sowie bei ärztlichen Fortbildungsveranstaltungen alles daran setze, meine Kolleginnen und Kollegen darüber zu informieren und für diese Thematik zu sensibilisieren. Einen dieser Vorträge, gehalten vor Gutachtern des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, habe ich nachträglich aufzeichnen lassen, um ihn hier einzustellen und somit das gegenwärtige Wissen zu diesem Krankheitsbild auch Nicht-Ärzten zur Verfügung zu stellen:
Fluorchinolone (FQ) waren 1960 die erste, vollsynthetisch hergestellte Gruppe von Antibiotika. Biochemisch betrachtet besteht die Gemeinsamkeit der Fluorchinolonantibiotika darin, dass das identisch aufgebaute Grundgerüst an einer Stelle ein Fluoratom trägt (siehe rotes F in der obigen Strukturformel). Der Unterschied zwischen den verschiedenen Vertretern dieser Klasse besteht in unterschiedlichen "Anhängseln", die in Nachbarschaft des Fluoratoms synthetisch angeheftet wurden (siehe blaues R in der obigen Strukturformel).
Aufgrund ihrer Wirkung gegen ein Enzym namens Gyrase, das im Zellkern für die Synthese der DNA (= Erbsubstanz) zuständig ist, wurden sie anfangs auch als Gyrasehemmer bezeichnet. Durch diesen gezielten Angriff auf die Erbsubstanz des Bakteriums war/ist ihre abtötende Wirkung auf Bakterien so hoch, dass man sie anfangs als „Panzerschrank-Antibiotika“ bezeichnete und diese neue Antibiotikagruppe als Reservemedikament gegen methicillinresistente Keime (MRSA) zurücklegen wollte.
Von den ursprünglich 16 verschiedenen Vertretern wurden in kurzer Zeit nach der Markteinführung jedoch 11 Präparate wegen schwerwiegender Nebenwirkungen wieder vom Markt genommen - was für sich genommen schon außergewöhnlich ist -, sodass heute nur noch 5 Wirkstoffe (Beispiel für Handelsnamen in Klammern) in der Apotheke erhältlich sind, und zwar:
- Ciprofloxacin (Ciprobay®)
- Levofloxacin (Tavanic®)
- Moxifloxacin (Avalox ®)
- Norfloxacin (Bactracid®, Barazan®)
- Ofloxacin (Oflox®, Floxal Augentropfen®)
Wegen der auch bei diesen Präparaten möglichen Nebenwirkungen und Spätschäden sollen sie jedoch nicht bei banalen Infekten eingesetzt werden, sondern nur als Reservemedikament bei Versagen anderer Antibiotika als ultima ratio erwogen werden.
Dies wurde allen Ärzten in Deutschland mit drei sogenannten Rote-Hand-Briefen im Oktober 2018, nochmals im April 2019 und erneut im Juni 2023 in Abstimmung mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) schriftlich mitgeteilt, ein weiterer, ungewöhnlicher Vorgang, denn Rote-Hand-Brief-Erinnerungen sind eine Rarität.
Nötig wurde die Erinnerungswarnung offenbar deshalb, weil FQ in Deutschland heutzutage immer noch breit und bei einfachen Infekten verordnet werden, obwohl auch die Beipackzettel der Hersteller ausdrücklich auf die Gefahren und Anwendungsbeschränkungen hinweisen.
Die zahlreichen, zum Teil schweren und in manchen Fällen auch irreversiblen Langzeitschäden beruhen offenbar darauf, dass dieser Antibiotikatyp beim Menschen dasselbe Enzym angreift wie im Bakterium und dadurch auch beim Patienten zu Schäden an der DNA führt.
Bezüglich der daraus entstehenden Symptomatik können vier große Schädigungsbereiche voneinander unterschieden werden:
1.) Oxidativer Stress und Schädigung der Mitochondrien.
Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen, sie stellen nicht nur körpereigene Antioxidantien, Enzyme und Proteine her, sondern auch das ATP = das Molekül, das den Körper mit Energie versorgt. Sind diese Mitochondrien geschädigt und entwickelt sich dazu noch oxidativer Stress, so kommt es zu folgenden Symptomen:
- Fatigue
- Allgemeine Immunschwäche
- kognitive Störungen, wie z.B. eingeschränkte Aufmerksamkeit, Sorgen, visuelle Wahrnehmungen, pathologische Geruchs- und Geschmackswahrnehmungen, mangelndes Abstraktionsvermögen uvam.
2.) Schädigungen an Muskeln, Sehnen, Bändern und Bindegewebe, was zu folgenden Symptomen führen kann:
- Schmerzen in Sehnen und Muskeln
- Plötzlicher, reißender, thorakaler Dissektionsschmerz bei Aortenaneurysma
- Sehnenrupturen ohne besonderen Anlaß
3.) Nervenschädigungen, was zu folgenden Symptomen führen kann:
- PNP (Polyneuropathie) mit sensiblen Störungen, z. B: Kribbeln, Ameisenlaufen, Gefühlsstörungen
- Neuropathische Schmerzen
- unspezifische gastrointestinale Symptome
- trockene Schleimhäute aufgrund der Schädigung der dortigen autonomen Nerven
4.) psychiatrische Nebenwirkungen, was zu folgenden Symptomen führen kann:
- Brain fog (Mangel an mentaler Klarheit)
- Nervosität, Agitation, Angst- und Panikattacke
- Psychosen, Halluzinationen
- Depersonalisation
- Schlafstörungen mit Albträumen
- Tinnitus
- Hypersensitivität für Licht und Lärm
- Tremor, Zuckungen
- Konzentrations- und Gedächtnisstörungen
- Depression
- Suizidalität
Diese Symptome, deren Auftreten und Stärke im zeitlichen Verlauf sowie Angaben zur Einnahme des oder der FQs werden in einem von Dr. Stefan Pieper entwickelten Fragebogen erhoben, der in dessen und meiner Praxis neben der Labordiagnostik (siehe Ganzheitliches Speziallabor und Mitochondiendiagnostik) Grundlage der Diagnosestellung und daraus abzuleitenden Therapie ist.
Der Grad der allgemeinen Leistungseinbuße läßt sich bei diesen Patienten darüber hinaus gut mit Hilfe der Bell-Skala bestimmen.
Die individuellen, spezifischen Funktionseinschränkungen werden mit der von der WHO herausgegebenen, Internationalen Klassifikation der Funktionsfäigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) beschrieben. Die wichtigsten und häufigsten Kodierungsschlüssel, die für die sozialmedizinische Beurteilung ausschlaggebend sind, lauten:
- Fatigue b130
- Allgemeine Immunschwäche b435
- Aufmerksamkeitsstörungen b140
- Sorgen b152
- Visuelle Wahrnehmungsstörungen b1561
- Eingeschränkte Geruchswahrnehmung b1562
- Verminderte Geschmackswahrnehmung b1563
- Eingeschränktes Abstraktionsvermögen b1640
- Schmerzen in Sehnen und Muskeln b2802
- Plötzlicher, reißender, thorakaler Dissektionsschmerz b28011
- Schmerz bei Sehnenruptur ohne besonderen Anlaß b2801
- Polyneuropathie mit sensiblen Störungen b270
- Neuropathische Schmerzen b289
- Dumping-Syndrom b5150
- unspezifische gastrointestinale Symptome b535
- trockene Schleimhäute bei Schädigung der autonomen Nerven s330
- Brain fog (Mangel an mentaler Klarheit) b130
- Nervosität, Agitation, Angst- und Panikattacke b1304
- Psychosen, Halluzinationen b1309
- Depersonalisation b1800
- Schlafstörungen mit Albträumen b134
- Tinnitus b2400
- Hypersensitivität für Licht und Lärm b21020
- Tremor, Zuckungen b7651
- Konzentrations- und Gedächtnisstörungen b144
- Depression b130
- Suizidalität b130
Näheres hierzu finden Sie in Kapitel 3.7.3 des unten genannten Lehrbuches von Dr. Stefan Pieper (ISBN-Nr eBook: 978-3-662-69763-4)
Die Besonderheit des FQAD liegt im Gegensatz zu anderen Erkrankungen darin,
- dass es kein sogenanntes Leitsymptom gibt, das auf die Diagnose hindeutet, weil so vielartige Symptome gleichzeitig und in unterschiedlichen Kombinationen auftreten können,
- dass die Krankheit in Schüben verläuft,
- dass zum Teil eine lange Latenz zwischen der Einnahme des Antibiotikums und dem ersten Auftreten der Symptome verstreichen kann (Stunden bis zu einem Jahr!),
- dass deswegen auch eine hohe Dunkelziffer zu beklagen ist,
- und dass die Patienten oftmals erst nach einer langen Odyssee mit dicken Leitz-Ordnern voller Vorbefunde bei einem Arzt oder Heilpraktiker "landen", der an diese Differentialdiagnose denkt.
Die Therapie ist diffizil und langwierig. Im Vordergrund steht der Ausgleich des oxidativen Stresses durch p.o.- oder iv.-Gabe von Antioxidantien, die Substitution von Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen, Lymphdrainage und IHHT, der intermittierenden Einatmung von sauerstoffreicher und sauerstoffarmer Luft, die zur Gesundung der Mitochondrien beiträgt.
Weitere Informationen finden Sie in dem Lehrbuch von Dr. Stefan Pieper Fluoroquinolone Associated Disability (FQAD) Nebenwirkungen von Fluorchinolonen, 2. Auflage 2025 (ISBN-Nr.: 978-3-662-69762-7), sowie unter: www.fqad-support.com